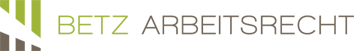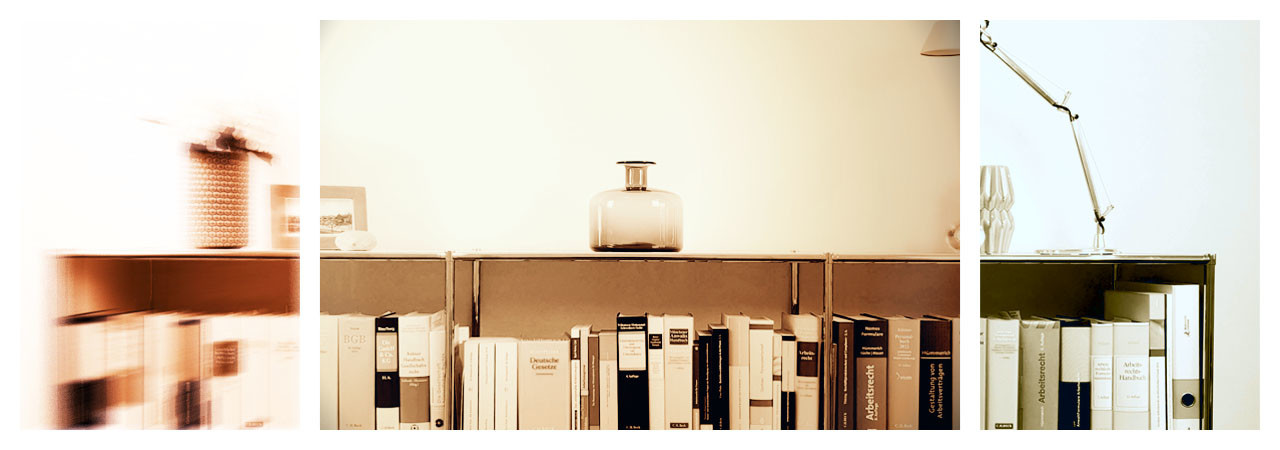Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung unzulässig
Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrags ist nicht zulässig, wenn zwischen dem Arbeitnehmer und der Arbeitgeberin bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das gilt jedenfalls dann, wenn das alte Arbeitsverhältnis lediglich acht Jahre zurückliegt und ca. 1,5 Jahre dauerte. Weitere Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer in dem früheren Arbeitsverhältnis eine vergleichbare Arbeitsaufgabe hatte. Das hat das Bundesarbeitsgericht unter Korrektur seiner bisherigen Rechtsprechung mit seinem Urteil vom 23.01.2019, Az.:7 AZR 733/16 entschieden. Der Arbeitnehmer war bereits zuvor bei dem Arbeitgeber beschäftigt In dem von dem Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall war der Kläger erstmals von März 2004 bis September 2005 befristet bei dem Arbeitgeber beschäftigt. Er wurde seinerzeit als gewerblicher Arbeitnehmer eingestellt. Im Jahr 2013 schloss der Arbeitgeber erneut einen befristeten Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer. Dieses Mal wurde er als Facharbeiter beschäftigt. Der Arbeitsvertrag wurde zunächst sachgrundlos befristet auf den Zeitraum vom 19.08.2013 bis zum 28.02.2014. Die Parteien verlängerten die Vertragslaufzeit mehrfach, zuletzt bis zum 18.08.2015. Nachdem der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mitgeteilt hatte, dass sein befristetes Arbeitsverhältnis nicht mehr verlängert wird, setzte sich der Arbeitnehmer gegen die Befristung vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Das Arbeitsgericht, das Landesarbeitsgericht und jetzt auch das Bundesarbeitsgericht befanden die Befristung für unwirksam. BAG ändert Rechtsprechung zu Berücksichtigung von Vorbeschäftigungen Der Arbeitnehmer berief sich in seiner Klage auf die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Diese lautet wie folgt: „Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat.“ Der Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist eigentlich eindeutig. Gleichwohl hatte das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2011 [...]